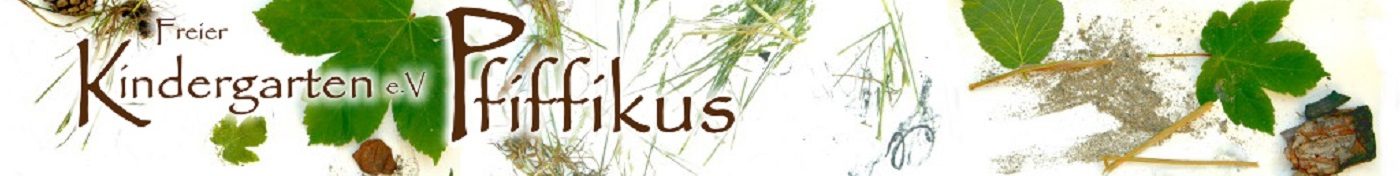Ringmodell – auf einen Blick

Nichtdirektives Begleiten
Wir wollen die Kinder durch unser aufmerksames, nicht-direktives Begleiten und durch unsere aufmerksame Präsenz unterstützen.
Die Achtung als Grundlage unserer pädagogischen Arbeit findet durch unser aufmerksames, nicht-direktives Begleiten und durch unsere aufmerksame Präsenz ihre Verwirklichung und zeigt sich darin, dass wir das Kind nicht „überbehüten“, dass wir ihm erlauben, seinen Weg zu finden und uns nicht ständig mit unserem Wissen einmischen und zeigen, wie etwas „richtig“ gemacht wird. Insofern ist es sinnvoll, dass wir unseren Impuls zu helfen hinterfragen – dass wir innehalten und erst einmal abwarten, was das Kind von sich aus tut. Wir versuchen zurückzutreten von der aktiven und direkten Steuerung und Kontrolle des Geschehens; d.h. wir vermeiden:
- den Kindern schnell das abzunehmen, was schwierig für sie ist
- Ablenkungsmanöver in schwierigen Situationen
- ihrer Initiative und eigenen Absichten vorzugreifen
- ihre Gefühle zu manipulieren
- ihrem Denken „erwachsene“ Erklärungen überzustülpen
- Lösungen vorzugeben
- das Kind in seinem Tun zu unterbrechen, zu stören (eine Störung kann unter Umständen schon sein, wenn wir um unser Interesse zu bekunden, zu ihm hintreten mit der Äußerung: „na, was spielst du denn da“ oder „du spielst aber schön“).
Nicht-direktives Begleiten bedeutet in keinster Weise, die Kinder sich selbst zu überlassen, sondern es bedeutet, hinzuhören, neugierig zu sein, hinzuschauen und das Kind und seine Prozesse in seiner ´Ganzheit´, auf der Basis von Respekt zu beachten und wahrzunehmen. Diese Form von (Be)Achtung beinhaltet auch, die „sekundären“ Signale, welche sich in den verschiedenen „Wahrnehmungskanälen und -ebenen zeigen, wahrzunehmen, und, je nach Situation, die Signale aufzugreifen, darauf zu reagieren, oder sie zumindest „im Auge zu behalten“.
Aufmerksames beobachten
Aufmerksame Präsenz und aufmerksame Beobachtung ist ein fundamentales „Instrumentarium“ unserer Arbeit. Aufmerksame Beobachtung erfolgt mit einer von Achtung geprägten Haltung, d.h. ohne Wertung und Be- oder Verurteilung, und es impliziert, dass wir mittels Beobachtung der Tätigkeit des Kindes, bzw. dem Kind selbst Beachtung schenken. Das Wort in sich erklärt den Sinn und die Bedeutung des Beobachtens: durch eine mit Achtung durchgeführten Be(ob)achtung erfährt das Kind (Be)Achtung. Dies ist auch die Art und Weise wie wir dem Kind gegenüber unsere Anerkennung – Kinder wollen gesehen werden und wollen ihre Freude über bewältigte Aufgaben teilen – ausdrücken. Wir „verzichten“ dabei auf Lob in Form von: „das kannst du aber gut“ oder „das ist ja schön“ …, wir teilen mit ihm seine Freude, indem wir ihm unsere ungeteilte Beachtung schenken und sein Tun in Worte kleiden. Es kann leicht passieren, dass das Kind etwas nicht mehr macht, um zu seiner inneren Befriedigung zu gelangen, sondern, weil es gelernt hat damit Anerkennung vom Außen zu bekommen. Dazu ein kurzes Beispiel: Alexander hat erstmals ohne Hilfe ein Holzpuzzle geschafft – (ein Puzzle, welches auf verschiedene Arten zusammengesetzt werden kann). Strahlend berichtet und zeigt er dies der Kindergärtnerin. Diese lacht zurück: „ja, Alexander, du hast es heute ganz alleine gemacht und ich sehe, wie viel Freude du damit hast. Alexander setzt sich wieder damit auf den Boden und probiert eine neue Variante des Zusammensetzens aus.
Das Beobachten ist wie das Zuhören eine Tätigkeit starken inneren Engagements und erfordert genauso wie das Zuhören großes Einfühlungsvermögen. Es ist kein Luxus, sondern pure Notwendigkeit, um angemessen helfend und unterstützend eingreifen zu können, wenn es notwendig ist.
Durch das innere Mitgehen und Miterleben grenzt es sich von dem „bloßen“ Zuschauen ab. Das Zuschauen hilft uns uns an die Situation, den Vorgang zu erinnern, doch sind dies nur sehr äußere Phänomene, die mit den inneren Vorfällen möglicherweise, aber nicht unbedingt etwas zu tun haben. Das Beobachten bedeutet vor allem „Das-bei-den-Kindern-Sein“, und ist eine Annäherung an ihre subjektiv so andersartigen Welt.
„Beobachten so verstanden, ist zuweilen auch deshalb nicht einfach, weil wir es meistens gewohnt sind „in Aktion“ zu treten und oft die Tendenz haben, das zu sehen was wir schon „wissen“, woran wir glauben, statt das was vor unseren Augen tatsächlich geschieht“ (1).
Literatur:
- Pikler, E./Tardos, A.: Miteinander vertraut werden. Freiburg 1997